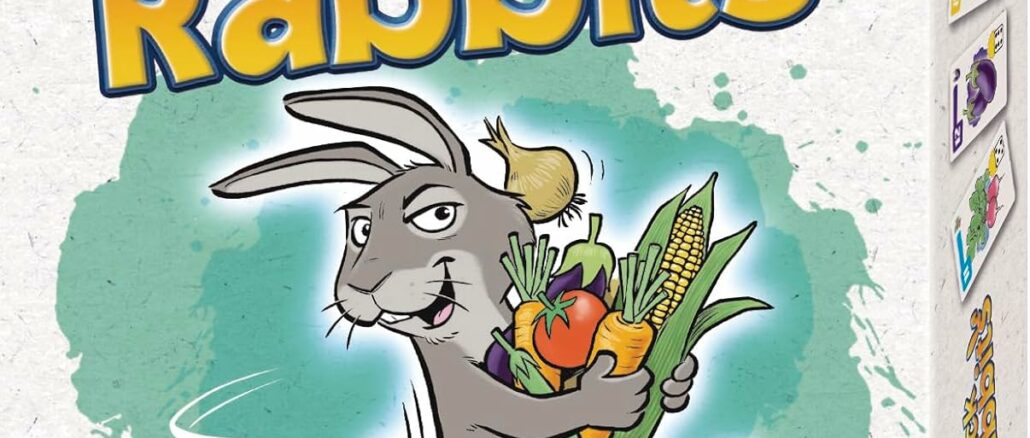Sehr geehrter Herr Michael Kröhnert,
Sie sind Dolmetscher, was auf den ersten Blick ja nichts Außergewöhnliches ist. Aber Sie übersetzen Spiele.
Michael Kröhnert: Ein Dolmetscher übersetzt mit Gebärden oder Sprache quasi „live“, was jemand anderes gerade gesagt hat, daher würde ich meinen Job doch lieber Übersetzer nennen. Zumal ich für die Übersetzung dadurch auch mehr Zeit habe.
Die Redaktion: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Spiele zu übersetzen?
Michael Kröhnert: Übersetzungen muss ich in meinem Hauptberuf als PR-Mann, Grafiker und technischer Redakteur zwar auch gelegentlich machen, aber sie stellen nur einen kleinen Teil der Arbeit dar.
Als mir als Jugendlicher die ersten englischsprachigen Spiele in die Hände gefallen sind, habe ich begonnen, rein privat Übersetzungen anzufertigen, damit ich das jeweils mit meiner Familie und Freunden spielen kann. Diese Spiele fand ich nämlich oft viel interessanter als das, was es so auf dem deutschen Markt gab. Und so wurden mit Vaters Schreibmaschine auf Tonpapier Aktionskarten getippt und aus Oberhemden-Pappkartons Spielpläne geklebt.
Als Student hatte ich mal bei jemandem das Vampirbrettspiel „The Fury of Dracula“ gespielt. Das fand ich großartig, und das war es auch wirklich. Ich konnte es mir selber aber nicht leisten, weil es 100 Mark gekostet hat. Das war in den 80er Jahren unerschwinglich für mich. Später war es regulär nicht mehr zu bekommen und es wurden nur noch Liebhaberpreise dafür bezahlt.
Für ein Nachbasteln aus der Erinnerung war es zu umfangreich. Aber es gab dann so viele andere Spiele zu entdecken, vor allem, als ich die US-Website Boardgamegeek entdeckt hatte (und dort viel Material fand, aber auch selber hochgeladen habe – oft eben auch Übersetzungen, einfach so aus Spaß).
Ich hatte Fury of Dracula fast vergessen, da tauchte vor etwa 10 Jahren die Neufassung von Fantasy Flight Games auf. Auf Englisch natürlich. Ich wollte das mit der Familie spielen und nicht alle verstehen gut Englisch. Ich habe also alle Karten eingescannt, die Texte rausgelöscht und meine übersetzten Texte eingesetzt, alles ausgedruckt, beschnitten, Ecken gerundet – und da kündigte der Heidelberger Spieleverlag die deutsche Fassung von Fury of Dracula an.
Mist, dachte ich. Aus einer Laune heraus habe ich der Redaktion mein Karten-PDF zugeschickt, mit dem Kommentar: „hier schaut mal, ich glaube, das ist mir gut gelungen, besonders die ausschmückenden Texte; wenn ihr möchtet, könnt ihr das benutzen.“ Ich hatte nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet. Aber die kam tatsächlich eine Weile später, als Frage: „Wir haben mit der Übersetzung noch nicht angefangen, aber deine sieht gar nicht schlecht aus. Willst du für uns vielleicht auch das Regelheft machen?“
Na klar wollte ich. Und danach kam ein Job nach dem anderen, inzwischen nicht nur von den Heidelbergern.
Die Redaktion: Dabei steht ja nicht nur die wortwörtliche Übersetzung im Mittelpunkt, sondern es muss ja auch stimmig sein. Gerade Codename ist ein Paradebeispiel dafür, denn bestimmte ursprüngliche Begriffe aus dem Original passen im Deutschen nicht. Wie gehen Sie dann an eine Übersetzung heran? Führen Sie dann selber Spielrunden durch oder wie muss man sich dies vorstellen?

Michael Kröhnert: Weit über die Hälfte der Begriffe der englischen Version des Spiels konnte ich nicht verwenden. Vor allem Teekesselchen, also Begriffe, die mehrere Bedeutungen haben können, waren gefragt.
Zunächst hatte ich kein Spielmaterial oder Regeln. Ich wusste nur, dass ich das Spiel übersetzen sollte, ein Muster, mit vorläufigen deutschen Begriffen, hatte ich auf Burg Stahleck gespielt, beim Heidelberger Spiele-Event, es war aber nicht in meinem Besitz.
Ich habe zunächst sehr viele Teekesselchen gesammelt und mir damit ein Handmuster des Spiels gebastelt. Das habe ich dann viel mit den unterschiedlichsten Leuten ausprobiert. Es hat funktioniert – und ich verrate hier ein Geheimnis: Codenames funktioniert immer! Man kann praktisch alles im 25er-Raster hinlegen und spielen, sogar Spielekartons. Aber: es funktioniert natürlich viel besser, wenn man sich ein paar Gedanken über die Begriffe macht.
Die Teekesselchen allein reichten nicht. Es mussten noch starke, eindeutige Begriffe her, solche, zu denen einem eine Menge Assoziationen einfallen. Berufe, geografische Begriffe, Tiere. Die begann ich zu suchen und etwas später kam die Mail vom tschechischen Verlag CGE, die genau erklärte, was für Wortgruppen sie haben wollten. Das deckte sich fast genau mit meinen Vorstellungen beziehungsweise Erfahrungen.
Als ich endlich die 400 Wörter zusammen hatte, ein harter Kampf bei manchen, musste ich dann auch noch entscheiden, welche Wortpaare jeweils auf eine Karte gedruckt werden sollten. Denn diese beiden könnten ja nie gleichzeitig auf dem Tisch liegen und es wäre blöd, wenn die beiden dann super zueinander passen würden. Leider (oder zum Glück?) ist es bei Codenames aber so, dass einem bei längerer Beschäftigung mit dem Spiel praktisch immer Assoziationen einfallen! Es war also wirklich schwierig, „schlecht passende“ Wortpaare zu finden.

Die Redaktion: Muss man als Spiele-Dolmetscher spielaffin sein?
Michael Kröhnert: Ja, absolut. Man muss das Spiel, an dem man da gerade arbeitet, nicht unbedingt mögen – aber man muss die Bereitschaft haben, sich in den Spielablauf reinzudenken. Sonst kommt bei der Übersetzung sehr wahrscheinlich viel Unsinn raus.
Bei Kleinverlagen finde ich oft auch Regellücken oder -fehler, auf die ich dann aufmerksam mache, wofür die sehr dankbar sind. Ich möchte, dass jedes Spiel, an dem ich arbeite, erfolgreich wird, auch wenn ich selber es nur während der Arbeit daran gespielt habe und dann nie mehr.
Ich übersetze ja häufig Spiele, die ich selber eher nicht zum Spielen aussuchen würde. Viele Sachen, an denen ich mitgearbeitet habe, spiele ich aber immer wieder gern: Takenoko zum Beispiel, A la carte, oder Battlestar Galactica und Codenames (oder dessen Nachfolger Codenames Pictures) sowieso.
Die Redaktion: Wie sind Sie zum Spielen gekommen?
Michael Kröhnert: Ich bin in den 60ern und 70ern aufgewachsen. Da hatten Gesellschaftsspiele einen hohen Stellenwert in der Familie, zumal es nicht so viele andere Zeitvertreibe gab. Natürlich waren das vor allem die Klassiker, Halma, Dame, Mühle, Mensch ärgere dich nicht und Rommé. Einer meiner ersten, heißesten Wünsche als 4- oder 5jähriger war ein Angelspiel – mit diesen Magnetangeln.
Hab ich tatsächlich bekommen, weil ich versprochen hatte, mir dafür das Daumenlutschen abzugewöhnen. Das habe ich auch eisern durchgehalten. Eine wichtige Voraussetzung fürs Spielen ist ja das Einhalten von vereinbarten Regeln, da hat sich sicher schon was abgezeichnet.
In den 70ern gab es den ersten Boom an besonderen, damals ungewöhnlichen und oft besonders schön ausgestatteten Spielen, die Serien von 3M fallen mir da ein. Da war’s um mich geschehen. Die Begeisterung hat bis heute angehalten.
Die Redaktion: Was fasziniert Sie beim Spielen?
Michael Kröhnert: Das Eintauchen in eine andere Welt mit eigenen Regeln. Das Kribbeln, wenn ein Plan vielleicht aufgeht. Die Mitspielerreaktionen im Spiel, aber auch bei dem Punkt, wenn Gelegenheitsspieler bei einer fast ewig langen Regelerklärung beinahe aussteigen wollen, und dann plötzlich mit Begeisterung bei der Sache sind und merken, dass man sich manche Spiele eben doch zu Beginn leider erarbeiten muss, um später richtig Spaß zu haben.
Die Redaktion: Was ist eigentlich Ihr Lieblingsspiel?
Michael Kröhnert: Oh weh, ich habe bestimmt zwei Dutzend, die ich nicht missen möchte. Ich sag mal so: wenn es um ein kurzes, schnelles Spiel geht, dann vielleicht Can’t Stop – wenn ich mehr Zeit investieren möchte, dann Der Ringkrieg. Und bei Partyspielen ist Time’s up (das jetzt Sag’s mir heißt) ein Dauerbrenner.
Die Redaktion: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Dolmetscher und einem Spieleautor?
Michael Kröhnert: Der Autor hat das Spiel entwickelt, kennt es in- und auswendig, und muss die Spielregeln aus seinem Kopf alleine oder mithilfe einer Redaktion zu Papier bringen. Ein Übersetzer muss im Idealfall „nur“ in eine andere Sprache umsetzen, was da geschrieben steht.
Das ist oft einfach, wenn die Spielregeln und das Material durchdacht sind. Manchmal aber muss man als Übersetzer fast das Spiel neu erfinden, weil man die ursprüngliche Regel nicht genau versteht. Das ist oft der Fall, wenn man das Spielmaterial nicht zu Gesicht bekommt. Leider kommt es häufig vor, dass man kein Spielmaterial bekommt, sondern nur die Spielregel, manchmal sogar ohne Abbildungen, wenn man übersetzt.
Die Redaktion: Würde Sie es nicht mal reizen, selber ein Spiel zu entwickeln?
Michael Kröhnert: Praktisch jeder in der Branche hat schon eigene Ideen mehr oder weniger weiter entwickelt. Ich habe bestimmt ein halbes Dutzend Spielideen in der Schublade. Da ich aber weiß, wie lange sich so etwas hinziehen kann, bis so ein Ding redaktionell bearbeitet ist und dann wirklich im Laden liegt, lasse ich das lieber.
Außerdem bin ich mein größter Kritiker und finde nur eine einzige meiner Spielideen gut genug, dass man sie veröffentlichen könnte. Da es sich dabei aber um ein (unblutiges) Zombie-Thema handelt und es schon viel zu viele Zombiespiele auf dem Markt gibt, halte ich lieber Abstand. Leider kann ich meiner Idee kein anderes Thema überstülpen, es funktioniert nur so.
Die Redaktion: Wie lange haben Sie für die Übersetzung des Spiels „Codenames“ benötigt, bevor es verlegt wurde?
Michael Kröhnert: Das kann ich gerade bei Codenames nicht mal annähernd genau sagen. Die Wortsuche hat wochenlang gedauert, auch durch die Testrunden. Aber das hat so viel Spaß gemacht, dass mir die Zeit nicht zu lange vorgekommen ist.
Die nicht sehr lange Spielregel jedenfalls hat auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, als das normalerweise der Fall ist, denn auch bei ihr konnte man nicht alles eins zu eins aus dem Englischen übernehmen.
Die Verbotsregeln, also welche Wörter man bilden darf und welche nicht, sind im Deutschen ein bisschen anders. Die musste ich mir erst ausdenken und gute Beispiele finden. Auch das hat manchmal stundenlang gedauert, bis ich einen Satz zu Papier gebracht habe.
Übrigens: Ich spiele Codenames immer viel lockerer als die strenge Spielregel. Es ist halt so ein typisches Partyspiel, wo der Spaß im Spiel viel wichtiger ist als exaktes Einhalten der Spielregeln, eine gute Punktzahl oder besser zu sein als die andere Gruppe.

Die Redaktion: Welches Thema würde Sie mal reizen, es spielerisch umzusetzen?
Michael Kröhnert: Zeitreisen – dazu gibt es schon viele, viele Spiele, einige sogar recht genial (T.I.M.E Stories zum Beispiel, Khronos – sehr kompliziert zu spielen, oder ZeitReise von FataMorgana, das viel simpler, aber auch sehr pfiffig ist), doch den absoluten Überknaller gibt es noch nicht.
Vielleicht könnte das mit App-Unterstützung irgendwann mal was werden.
Die Redaktion: Was planen Sie für die Zukunft?
Michael Kröhnert: Kein Witz: mehr spielen!
Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.